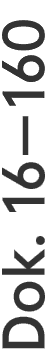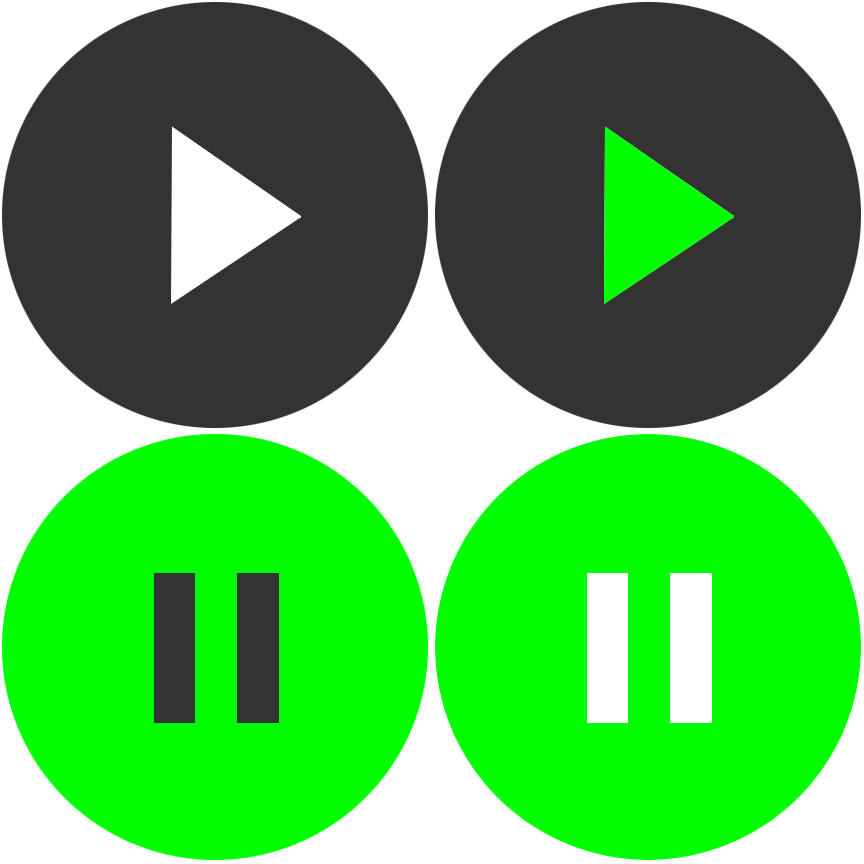Dok. 16-229
Die Häftlingsärztin Chaja Trocki betreut während des Räumungstransports aus dem Lager Helmstedt-Beendorf vom 10. April 1945 an kranke Häftlinge
Seit einigen Tagen leben wir in einem unbeschreiblichen Zustand

 Staatsgrenzen von 1937
Staatsgrenzen von 1937
Dr. Chaja Trocki-Musnicki (*1905), Ärztin und Zahnärztin; geboren in Chișinău, 1923 nach Belgien ausgewandert, bis Sommer 1944 im belg. Widerstand aktiv, am 31.7.1944 aus Mechelen nach Auschwitz deportiert, von Mitte Dez. 1944 an Häftlingsärztin in Helmstedt-Beendorf (Außenlager von Neuengamme), am 10.4.1945 auf Räumungstransport nach Hamburg, von dort nach Dänemark und Schweden; wohnte nach dem Krieg in Giwataim, Maonot Paolim (Israel).
Max Pauly (1907–1946), Verkäufer; 1928 NSDAP-, 1930 SS-Eintritt; Okt. 1939 kommissarischer Leiter von Stutthof, Febr. 1942 Kommandant von Stutthof, Sept. 1942 bis Mai 1945 Kommandant von Neuengamme; März 1945 SS-Staf.; 1946 im Hamburger Neuengamme-Hauptprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet.
David Trocki-Musnicki (1905–1945), Ingenieur; aus Vilnius nach Belgien ausgewandert, Ehemann von Chaja Trocki-Musnicki, im Jan. 1945 von Auschwitz nach Mauthausen überstellt, starb dort am 20.3.1945.
Bericht, aufgezeichnet in Schweden, Sommer 1945
Seit einigen Tagen leben wir in einem unbeschreiblichen Zustand fieberhafter Erwartung. Die Nachrichten, die uns über das Herannahen der alliierten Streitkräfte erreichen, machen uns nervös und ungeduldig. Wir haben kaum noch die Geduld, die Kranken hinauszubringen. Es mangelt an Medikamenten.
Am Freitag, den 6. April 1945, wechseln wir noch einmal alle Verbände, verrichten die übrige Arbeit und beschließen, uns am Samstag auszuruhen. Als es hell wird, wird uns mitgeteilt, dass Frauen nicht mehr hinunter zur Mine dürfen. Es ist ein ermutigendes Zeichen, offenbar rücken die Alliierten näher. Wir erfahren, dass sie 25 km entfernt sind. Zu diesem Zeitpunkt können wir uns noch nicht vorstellen, wie alles enden wird. Einige Kranke konnte ich mit der Vorstellung einer plötzlichen Befreiung am Leben erhalten, mit dem Bild eines Sanitätszugs, der sie so schnell wie möglich in ihre jeweiligen Heimatländer bringt. Uns wird eine weitere Ärztin an die Seite gestellt, wir haben sehr viel zu tun. Wir müssen 300 Kranke versorgen und machen tolle Pläne, wie wir unsere Arbeit organisieren werden, sobald wir frei sind, selbst darüber zu bestimmen. Wir sprechen nur flüchtig über Transportfragen. Margots Erfahrung sagt, dass die Deutschen wie immer, wenn der Feind naht, alles daransetzen werden, den Rückzug mit den Häftlingen anzutreten. Doch heimlich malen wir uns aus, wie der Aufbruch verhindert werden könnte. Es ist die Rede von Einkesselung und fehlenden Transportmitteln. In dieser fieberhaften und erwartungsvollen Stimmung erleben wir den Samstag und Sonntag, 7. und 8. April. Am Montag gibt der deutsche Sanitäter Bertha Bescheid, dass sie, wenn der Befehl zum Aufbruch kommt, alle Medikamente mitnehmen soll. Zu mir sagt er nichts, das gibt mir zu denken, möglicherweise sollen die Jüdinnen bleiben, dann sind also noch gewisse Aktionen gegen uns möglich, zumindest gegen die Kranken. Die Situation ist sehr unklar, niemand kann sich sicher sein. Und dann, am Dienstag, den 10. April, kommt der Befehl zum Aufbruch. In aller Eile müssen wir die Medikamente einpacken und unsere Päckchen schnüren. Die Bekleidungskammer wird ausgeräumt, den Häftlingen werden Mäntel, Wäsche und gestreifte Kittel zugeteilt. Die Bekleidungskammer wird hinter dem Rücken der Häftlinge leer geräumt. Unter den Kranken, insbesondere unter den Juden, die zuvor Auschwitz erlebt haben, herrscht seit zwei Tagen große Angst. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie mit den Übrigen evakuiert werden, und alles, was noch irgendwie laufen kann, will das Revier verlassen. Wer eine Mutter, eine Schwester oder Freundin hat, will hinaus, um mit ihr zusammen zu sein. Ich weiß selbst nicht, wozu ich raten soll. Ich erkläre die Situation, wie sie ist, und überlasse den Kranken die Entscheidung. Von den 300 sind noch 150 übrig, die Schwerkranken unter den Juden bleiben, die Arierinnen sind ruhiger, sie haben nicht solche Vernichtungsängste wie die Juden. Später werden wir feststellen, dass es ein schwerer Fehler war, das Revier zu verlassen. Ein Fehler, der viele vermeidbare Todesopfer gefordert hat. Doch in dem unvorstellbaren Durcheinander des überstürzten Aufbruchs, den ich den Deutschen niemals zugetraut hätte, wollten alle als gesund gelten. Für die Kranken sind vier Waggons vorgesehen. Selma und Margot werden für den Waggon mit den Schwerkranken eingeteilt und empfinden das als große Strafe. Sie beneiden mich darum, dass ich bei den leichter zu versorgenden Kranken bleibe.
So beginnt unser Geistertransport, unser Todestransport. Wir fahren zwölf Tage, um unser Ziel, Hamburg, zu erreichen, und unser Konvoi, der 3000 Frauen zählt, wird auf vier verschiedene Lager in der Nähe von Hamburg aufgeteilt.
Es ist beinahe unmöglich, den Transport selbst zu beschreiben. Es gibt keine Begriffe in unserem Wortschatz, um die Gräuel, diese Bestialität, diesen kollektiven Wahn zu schildern. Zu 120, 130 in einem Waggon zusammengepfercht, werden die Schwächsten angegriffen, vor allem unsere Jüdinnen. Die zweite Nacht des Transports ist überschattet vom Tod von fünf Jüdinnen in einem Waggon, in dem mehrheitlich Deutsche sind. Sie sind an Verletzungen aufgrund von Schlägen gestorben. Die Bilanz dieses Transports beläuft sich auf insgesamt 570 Tote, Männer und Frauen, die große Mehrheit Juden.
Stundenlang verbleiben die Toten in den Waggons, und die Kranken liegen auf ihnen. Der Anblick dieses Horrors macht mich völlig wütend. Ich kann kaum sprechen, kämpfe ständig mit den Tränen. Ohne Unterlass werde ich zu den Waggons gerufen, in denen die Frauen sterben wie Fliegen, vor Durst, vor Erschöpfung. Es sind 120 bis 150 Frauen pro Waggon zusammengepfercht. Es ist heiß. Wir bekommen kaum Luft. Nur eine schmale Tür steht offen. Ich beschwere mich bei unserem Transportleiter, vielleicht ist es möglich, die Fenster zu öffnen, für etwas frische Luft zu sorgen. Ich bekomme die zynische Antwort: „Was, sie werden sterben? Dann haben wir weniger zu transportieren!“ So viel zu der Verbesserung, die ich erwirkt habe. Und die Frauen sterben erschöpft vor Durst und Hunger. Unser Leidensweg dauert weiter an. Wir halten in einem Wald in der Nähe von Ludwigslust. Es wird gesagt, dass wir weder vor noch zurück könnten, wir seien eingekreist. Wir hören das Kanonenfeuer. Wir schätzen, dass die Alliierten noch 20 km von uns entfernt sind, manche sagen sogar, es seien nur 12 km. Neben uns liegt ein Lager, in dem sich 10 000 Männer befinden, die aus verschiedenen Lagern in ganz Deutschland evakuiert worden sind und den gleichen Leidensweg hinter sich haben wie wir, bis sie hierher gelangten. Die 2000 Männer, die mit auf unserem Transport waren, werden ebenfalls in diesem Lager untergebracht. Das Schicksal von uns 3000 Frauen bleibt ungewiss. Es ist vage die Rede davon, dass wir trotz allem nach Hamburg, nach Neuengamme weiterfahren. Der Lärm um uns herum stimmt uns skeptisch, wir glauben nicht mehr an die Möglichkeit eines Rückzugs. Wir warten drei Tage lang, ohne Verpflegung. Es werden nur die Toten abtransportiert. Und dann geht die Fahrt doch weiter. Schon auf der Fahrt nach Hamburg wird als Ziel Dänemark erwähnt. Am 21. April kommen wir schließlich in Hamburg an, wo der Kommandant von Neuengamme eintrifft. Als Erstes fährt die Gruppe der holländischen Jüdinnen, die Philipsgruppe, ab, die in ein Lager nicht weit von Hamburg, nach Eidelstedt, kommen. Eine Nacht lang steht unser Zug noch am Hamburger Bahnhof, bevor er am 22. April frühmorgens aufgeteilt wird und in drei verschiedene Lager in der Umgebung von Hamburg weiterfährt. Wir, eine Gruppe von 900 Frauen, kommen nach Ochsenzoll in der Nähe von Langenhorn. Wir brechen wieder auf. Es ist vage vom Roten Kreuz die Rede, an das wir überstellt werden sollen. Nichts ist sicher. Wir gehen zu Fuß bis zum Hamburger Bahnhof, der zwei bis drei km vom Lager entfernt liegt. Als wir ankommen, erwartet uns ein ganzer Konvoi von Waggons. Nach Nationalität getrennt, werden wir zu jeweils 55 Personen auf die Waggons verteilt, die mit Stroh ausgelegt sind und von jeweils zwei deutschen Posten begleitet werden, die aber nicht der SS, sondern der Polizei angehören. Von den Posten erfahren wir die großartige Neuigkeit, dass wir nach Dänemark fahren und sich das Rote Kreuz unser annehmen wird. Noch am selben Abend erhalten wir eine ordentliche Ration Brot und Margarine. Und auf geht’s, auf geht’s nach Dänemark. Wir fahren den ganzen 1.Mai. Während der Fahrt sehen wir die deutsche Armee tatsächlich auf der Flucht, Zivilisten, die sich in Sicherheit bringen. Im Lauf unserer Reise erfahren wir, dass die Engländer und Amerikaner schnell vorankommen, dass Hamburg, das wir hinter uns gelassen haben, kapituliert hat, Berlin besetzt ist und Hitler und Mussolini tot sind. Am Abend des 2. Mai erreichen wir die dänische Grenze. Wir erfahren, dass wir in Padborg übernachten und am nächsten Tag nach Schweden weiterfahren, in die Freiheit. Diese Nachricht löst herzzerreißende Freudenszenen aus. Viele wissen, dass sie alles verloren haben, ihre Eltern, ihre Kinder, dass sie weder Familie noch Heimat haben. Doch das Leben ist stärker. Es erobert sich sein Recht. Freude herrscht vor allem unter den jungen Leuten, die sich trotz allem unbesorgt zeigen. Es wird viel gesungen und gelacht. Doch meine eigene Freude vermischt sich mit viel Traurigkeit. In unserem Lager in Beendorf sind 150 Juden eingetroffen, Ungarn und Polen (die meisten aus Łódź). Von ihnen erfuhr ich, dass sie in einer Autofabrik gearbeitet hatten, nach 7 Monaten waren 650 Männer tot, und die 150, die bei uns ankamen, waren nur noch Haut und Knochen. Ja, so waren diese Transporte! Vernichtungstransporte. Nichts von dem, was ich in Erfahrung brachte, konnte meine Befürchtungen, meine Ängste lindern. Ebendeshalb war meine Freude eher mäßig und von viel Kummer durchsetzt, trotz dieser großartigen Sache, die wir seit so langen Monaten erwartet hatten: die Freiheit